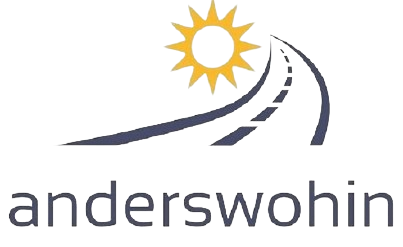In der Klosterruine Memleben finden einen interessanten Ort deutscher Geschichte, historisch bedeutend und zugleich mysteriös. Memleben, ein kleines Dorf mit einer riesigen Ruine. Ein Ort, den Könige und Kaiser besuchten und der Ort an dem Heinrich I. und Kaiser Otto der Große starben.
Wir sind unterwegs im Burgenlandkreis, in der Kulturregion Saale-Unstrut, die im südlichen Sachsen-Anhalt liegt. Hier in Memleben, am Ufer der Unstrut, stehen Pfalz und Kloster Memleben.
Memleben, ein fast vergessener Ort deutscher Geschichte
Wir parken an der Klostermauer und blicken auf das riesige sogenannte Kaisertor. Das ist das Tor zur Pfalz, dachte man lange Zeit. In Wirklichkeit aber war das Tor zur Klosteranlage mit einer gewaltigen Kirche hinter der Klostermauer. Wo die Pfalz stand, weiß man bis heute nicht sicher.
- Das sogenannte Kaisertor in Kloster Memleben
Wir gehen entlang der hohen Klostermauer zum heutigen Eingangsgebäude. Vor Jahren noch war der Ort deutscher Geschichte fast Vergessen. Erst in jüngster Vergangenheit besinnt man sich wieder auf seine Bedeutung von vor 1000 Jahren.
Wir betreten die Anlage, deren wichtige Teile eine Ruine sind.
Heinrich I. und Otto der Große starben in Memleben
Hier irgendwo stand eine Pfalz, die Heinrich I. öfter aufsuchte. Das war vor über tausend Jahren, um das Jahr 900. Heinrich I. war der König des Ostfrankenreiches. Eigentlich war er der erste deutsche König im deutschen Reich. Ursprünglich übrigens aus dem Harz, der gar nicht weit entfernt ist. Heinrich I. starb hier in der Pfalz Memleben. Vermutlich an einem Schlaganfall. Das war am 2. Juli 936. Begraben wurde er in der Stadt Quedlinburg im Harz.
Zu Lebzeiten hatte Heinrich I. das Reich seinem Sohn Otto vermacht, der als Kaiser Otto der Große in die Geschichte eingehen sollte. Das Jahrhundert der Ottonen begann mit ihm.
Otto I. war auch mehrmals in der Pfalz Memleben. Er hat Italien erobert und sich vom Papst, so wie sein Vorbild Karl der Große, zum Kaiser krönen lassen Im Jahr 973 wollte er in Memleben das Pfingstfest verbringen. Und hier, am Sterbeort seines Vaters, starb auch er. Das war am 7. Mai 973.
Sein Sohn und Nachfolger Otto II. lebte da schon im Memleben. Zum Gedächtnis an seinen Vater ließ er hier 979, zusammen mit seiner Frau Theophanu, ein Benediktinerkloster mit einer gewaltigen Kirche errichten. Seine Frau Theophanu war übrigens die Nichte des byzantinischen Kaisers. Nach ihrem Tod wurde sie in Köln begraben.
- Der mit Pflastersteinen gekennzeichnete Grundriss der Monumentalkirche Memleben
- Die Aussichtsplattform (links) mit Teilen der Klosterruine
- Ein Plan zeigt, wie die Monumentalkirche ausgesehen haben soll
Wo wurde das Herz von Otto dem Großen begraben?
Damals war es üblich toten Herrscher die inneren Organe zu entfernen, damit der Leichnam präpariert werden konnte. Das machte man wohl auch mit Otto dem Großen, der später in Magdeburg bestattet wurde. Die Legende sagt, dass sein entnommenes Herz hier in Memleben begraben wurde. Der Ort ist unbekannt. Vermutlich aber liegt es im Kloster und eventuell sogar in der Klosterkirche.
Kloster Memleben erhielt viele Schenkungen durch Otto II. und war somit ein reiches Kloster. Auch der nächste König, Otto III., suchte Pfalz und Kloster Memleben mehrfach auf. Zu dieser Zeit hatte Memleben eine ähnlich große Bedeutung wie die Reichsklöster Fulda, Corvey und Reichenau.
Heinrich II., der nächste Herrscher auf dem Thron, allerdings entzog dem Kloster alle Privilegien und Rechte. Das war 1015. Memleben nämlich war das Opfer eines Tauschgeschäfts. Heinrich II. erhielt für Memleben, das dem Kloster Hersfeld unterstellt wurde, Güter für sein Bistum Bamberg.
1033 war dann mit Konrad II. zum letzten Mal ein römisch-deutscher König in Memleben.
- Ruine der Klosterkirche im Kloster Memleben
- Ruine des Klosters in Memleben
- Kirchenruine im Garten des Klosters Memleben
Eine Monumentalkirche für Otto den Großen
Von einer Aussichtsplattform blickt man auf die Reste der Monumentalkirche aus dem 10. Jahrhunderts. Man sieht Mauerteile vom Querhaus, eine Langhauswand und ein Teil des Vierungspfeilers. Die Kirche war eine Doppelchoranlage. Ihre Länge betrug 82 Meter, ihre Breite fast 40 Meter. Nach den Ausgrabungen hat man den Grundriss der Kirche durch Pflaster sichtbar gemacht. Der Eindruck, den diese riesige Kirche damals hinterließ, man gewaltig gewesen sein.
Im 12. Jahrhundert baute man neben der Monumentalkirche eine neue, kleinere Klosteranlage. Auch deren Kirche ist heute eine Ruine. Die heute noch stehenden Mauern der Klosterkirche aus dem 13, Jahrhundert sind beeindruckend.
1525 wurde das Kloster im Bauernkrieg geplündert. In der Reformation wurde es aufgehoben, also geschlossen. Das war 1548. Das Kloster verfiel. Man begann im 18. Jahrhundert mit dem Abriss. Vermutlich verwendete man die Steine für den Bau von Wohnhäusern.
Erst vor einigen Jahrzehnten begannen, nach archäologischen Ausgrabungen, die Instandhaltungsarbeiten. Die Ruinenteile wurden gesichert, andere Klostergebäude wieder aufgebaut.
„Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben“
Heute heißt die Anlage „Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben“. In den Klausurgebäuden gibt es mehrere Ausstellungen. Themen sind der Alltag der Benediktiner; es geht um die Buchherstellung in ottonischer Zeit, um das Begräbnis Otto II.; es geht um Religion und Glaube in ottonischer Zeit und eine Ausstellung mit dem Titel WISSEN + MACHT. Da dreht sich alles um den heiligen Benedikt und die Ottonen, um den Orden und die Könige und Kaiser und was sie im Memleben zusammenführte.
Sehenswert ist die Krypta der Klosterkirche. Sie ist der einzige im Originalzustand erhaltene Raum der Klosteranlage. Der Raum, es ist dunkel hier, ist faszinierend.
Neben der Kirchenruine liegt der Klostergarten. Hier wachsen heute Pflanzen, die im 10. Jahrhundert in Benediktinerklöstern angepflanzt wurden. Auch ein sehenswerter Ort.
In Pfalz und Kloster Memleben sind wir eingetaucht in einen interessanten Teil deutscher Geschichte. Dank Orten wie Memleben gibt es die Gelegenheit diese Zeit Besuchern näherzubringen.